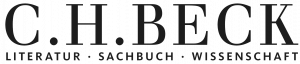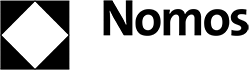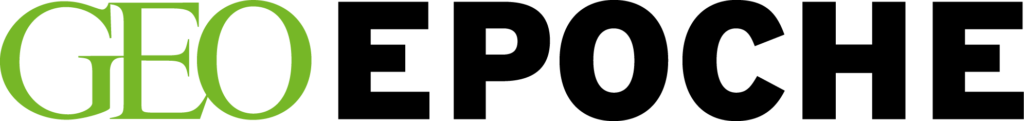„Open“ – mehr als ein Modewort
Eine Geschichte der Digitalisierung wird von zukünftigen Generationen vielleicht mithilfe des Worts „open“ beschrieben. Durch mehrere Deutungsmöglichkeiten scheint der Begriff zugleich Gegenwartsverständnis und Zukunftserwartungen zu fassen: Er kann etwas Freies, nicht Verschlossenes und auch etwas Offenes und Aufgeschlossenes meinen. Open Acces, Open Source, Open Data, Open Space, Open Innovation und Open Government sind nur einige Beispiele für diese derzeit zunehmend gebrauchten und mit allerhand Erwartungen verbundenen Kompositionen. Inhaltlich sind ihnen ein (weitgehend) freier Zugang und Partizipation und Transparenz fördernde Elemente gemein. Das wirkt sehr modern, doch schon vor einigen Jahrzehnten entwickelte sich „open“ zu einem zentralen Begriff – zumindest in der Philosophie.
Es war im Jahr 1945 als der Philosoph Karl R. Popper sein Buch „The Open Society and Its Enemies“ („Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“) veröffentlichte. Unter dem Eindruck totalitärer Ideologien beschrieb er eine friedliche, demokratische Gesellschaftsform auf Grundlage seiner Wissenschaftstheorie der Falsifikation. Genauso wie jeder Wissenschaftler und jede Wissenschaftlerin die Möglichkeit haben sollte, bestehende Hypothesen zu falsifizieren und zu verwerfen, ist es in Poppers offener Gesellschaft möglich, die Regierung zu falsifizieren und sie gewaltfrei abzuwählen. Kerngedanke ist bei beidem das offene Gebilde: Während geschlossene Systeme gegen Kritik und somit auch gegen Fortschritt abgeschottet sind, erlaubt es die Offenheit, Kritik zu äußern – sie führt zu Dynamik und letztendlich zur Weiterentwicklung und zur Verbesserung.
Man mag Poppers Theorien zustimmen oder auch nicht, zumal seine geschichtsphilosophischen Überlegungen unter Historikerinnen und Historikern so manchen Widerspruch hervorrufen. Einleuchtend bleibt jedoch das Prinzip der Offenheit als Bedingung einer Weiterentwicklung. Dass dieses in der Historiografie nicht immer gegeben ist, zeigt ein Blick in den Opernsaal der Geschichtswissenschaft.

Der Opernsaal der Geschichtswissenschaft
Die obligatorische Eintrittskarte in den Saal der Geschichtswissenschaft ist das universitäre Studium. Um einen Platz auf dem Parkett zu bekommen, ist eine Promotion unabdinglich. Die vorderen Reihen sind habilitierten Personen vorbehalten und die wenigen Logen werden von besonders herausragenden Vertreterinnen und Vertretern des Fachs, also Lehrstuhlinhaberinnen und -inhabern besetzt. Auf der Bühne wechseln sich meist die Besitzerinnen und Besitzer der Logenplätze ab, halten Vorträge oder debattieren auf Podiumsdiskussionen, während im dunklen Orchestergraben, vor den Blicken des Publikums weitgehend verborgen, der akademische Mittelbau das Ganze engagiert untermalt.
Dieses Bild ist vereinfacht, beschreibt aber ein immer wieder vorfindbares Phänomen. Oft sind es gerade die Ausnahmen, die besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen und so den verfestigten Aufbau des Gebildes verraten. Doktoranden, die wegen außergewöhnlicher Arbeiten aus dem Orchestergraben auf die Bühne gerufen werden, jedoch ohne die erste Geige spielen zu dürfen, Privatdozentinnen, die aufgrund ihrer hervorragenden Lehre einen Logenplatz erhalten und Nichtakademikerinnen, über die aufgrund ihrer außergewöhnlichen Forschungen kurzzeitig im Saal getuschelt wird.
Verfestigt wird diese Struktur von innen und von außen: von innen durch den vermeintlichen Selbsterhaltungstrieb der Geisteswissenschaften, die eigene Position hervorzuheben und so gegen einen möglichen Verlust der Deutungshoheit zu sichern; von außen, weil auch in der Öffentlichkeit der Inhalt der Forschung anhand des Sitzplatzes beurteilt wird. Wo jemand sitzt entscheidet mitunter eher über die Chance zum Bühnenauftritt als die durch das wissenschaftliche Arbeiten hervorgebrachten Fragen und Antworten. Mit neuen Ideen und Methoden wird oft träge umgegangen; manchmal verhindert ausgeprägtes Abgrenzungsverhalten nötige und zeitgemäße Innovationen. Eine Öffnung verspräche an verschiedenen Stellen mehr Dynamik und Teilhabe, sowohl die Öffnung des Zutritts als auch die Öffnung der Bühne.
Vorhang auf – vom Ideal zum Experiment
Eine Öffnung der Geschichtswissenschaft könnte in der Praxis bedeuten: Jede und jeder, der sich inhaltlich und nach wissenschaftlichen Kriterien mit Geschichte befasst, hat Zugang zum Saal, zum Austausch, zur Kritik und zur Bühne. Fragen, Inhalte und Überlegungen bestimmen die Art der Teilhabe. Eigentlich so, wie es in einer guten Seminarsitzung schon heute vielerorts stattfindet: Gemeinsam wird ein vorbereitetes Thema erarbeitet, erschlossen und kritisch hinterfragt. Die Dozentin oder der Dozent stoßen ein Thema an, eröffnen einen Raum des Austauschs und achten auf eine faire und wissenschaftliche Arbeitsweise. Die Hierarchie zwischen Lehrenden und Lernenden rückt genauso in den Hintergrund wie strategisches Gemauschel, das Thema dafür in den Vordergrund. Kritische Fragen aller Beteiligten beleben die Diskussion. Nichtwissen wird nicht als Unbelesenheit oder gar Faulheit abgestempelt, sondern als Ausgangspunkt jeglicher Wissenschaft anerkannt und geschätzt. Die Debatten werden sachlich, mit gegenseitigem Respekt und in einer allen verständlichen Sprache oder zumindest mit dem Bemühen nach gegenseitiger Verständigung geführt.
Ähnlich kann es sich auf Konferenzen und an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit verhalten. Nicht die Reputation, die besten Beziehungen oder die Lautstärke bestimmen wer gehört wird, sondern die Inhalte. Wortmeldungen aus dem Publikum werden ernst genommen und überdacht, genauso wie diese Wortmeldungen nur stattfinden, wenn sie wirklich Inhaltliches beitragen oder echte Fragen sind. Die Beteiligung fachfremder Personen ist erwünscht und wird als Bereicherung der eigenen Perspektiven gesehen. Die Zusammenarbeit und die Auseinandersetzung zwischen Menschen mit unterschiedlichem Erfahrungshintergrund, unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Interessen wirft neue Fragen auf und führt zu neuen Antworten.
Die Öffnung der Geschichtswissenschaft sorgt für eine Bereicherung derselben und gleichzeitig für eine trefflichere Annäherung an das, was erforscht und erfragt wird. Auch wenn es sich hier um eine nicht in allen Punkten umsetzbare Idealvorstellung handelt, so ist doch die skizzierte Richtung gewinnversprechend. Dass damit nicht unbedingt Einbußen in qualitativer Hinsicht verbunden sind, sondern ganz neue und hochwertige Ergebnisse geschaffen werden können, ist Teil dieser These. Ist es möglich, Wissenschaft und Geschichtsvermittlung so zu organisieren und durchzuführen, dass eine breite Rezeption und somit auch eine breite Teilhabe gegeben sind? Das histocamp kann auch als Experiment zu dieser Fragestellung verstanden werden, als ein Praxistest, dem hoffentlich noch viele weitere in unterschiedlichster Form folgen.
Die Öffnung ist in vollem Gange
Die gute Nachricht: Die Öffnung ist in vollem Gange. Immer mehr Quellen werden digitalisiert und erlauben so einen freien Zugang zu den Grundlagen der Forschung. Wissenschaftliche Arbeiten werden im Internet frei zugänglich gemacht, der Austausch darüber findet vermehrt per Social Media statt und auch bei Vorträgen und Podiumsdiskussionen wird das virtuelle und das reale Publikum mehr und mehr mit einbezogen. Diese Entwicklung ist kein Selbstläufer. Sie wird durch die Möglichkeiten der Technik bedingt und durch das Engagement von Vorreiterinnen und Vorreitern langsam etabliert. Diesen und allen anderen geschichtsinteressierten Menschen kann Open History e. V. ein Forum bieten. Dabei muss die Geschichtswissenschaft nicht revolutioniert, nur vielleicht an jenen Stellen ein wenig wachgerüttelt werden, wo sie träge im Opernsaal sitzt. Lasst uns über eine moderne und offene Geschichtswissenschaft und -vermittlung nachdenken und sie aktiv ausprobieren.